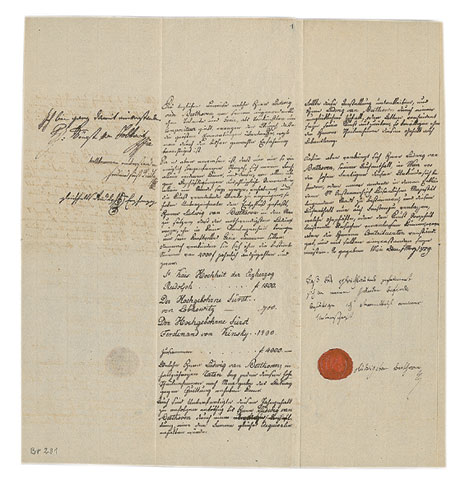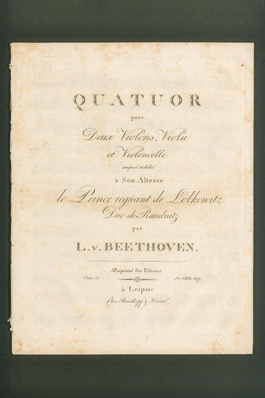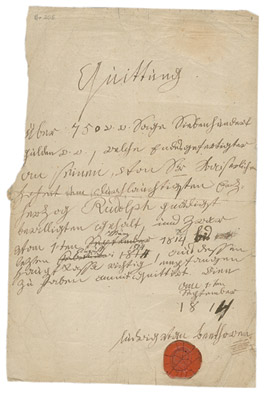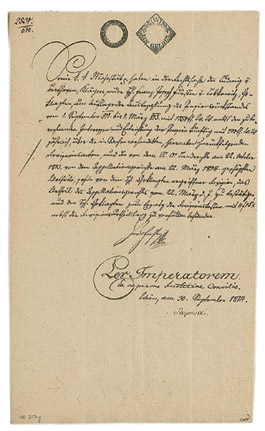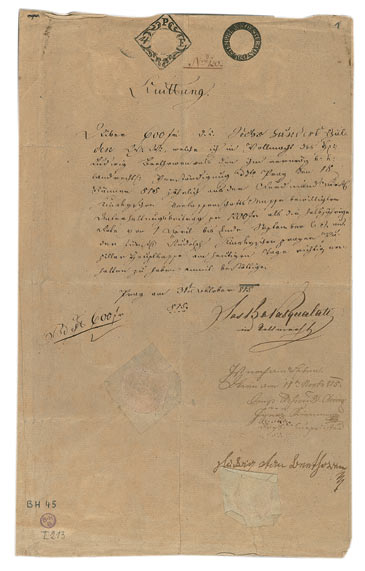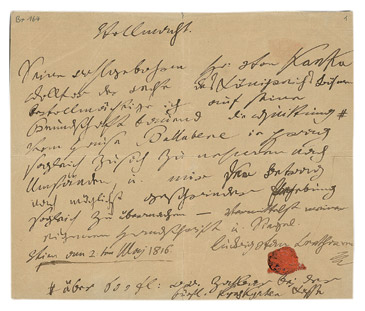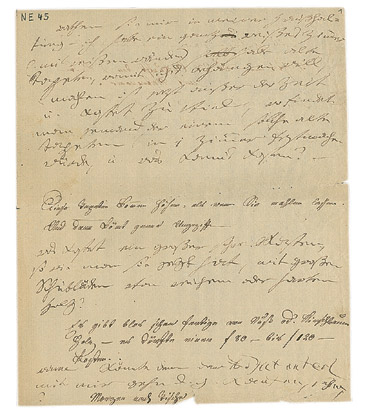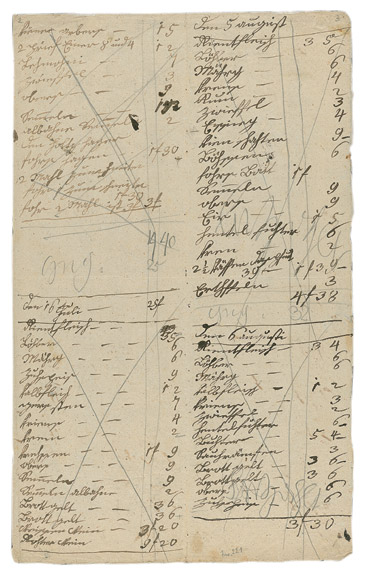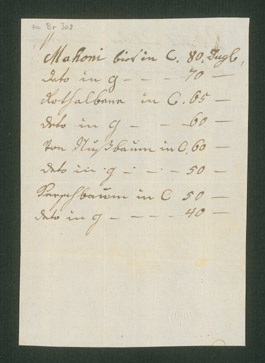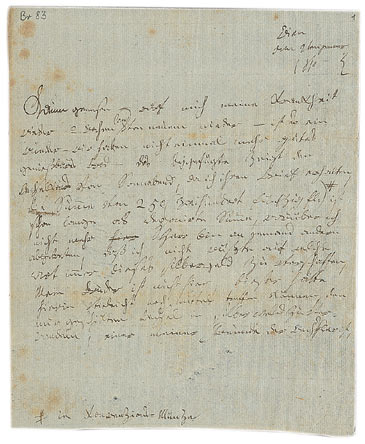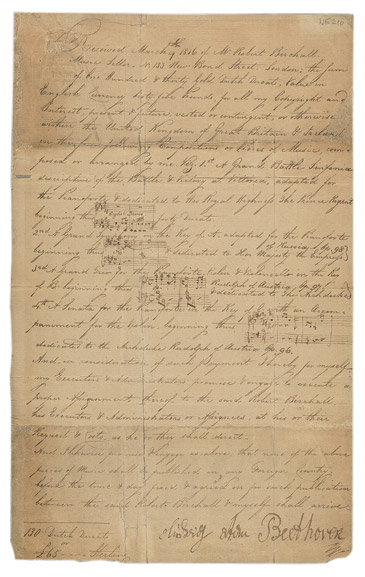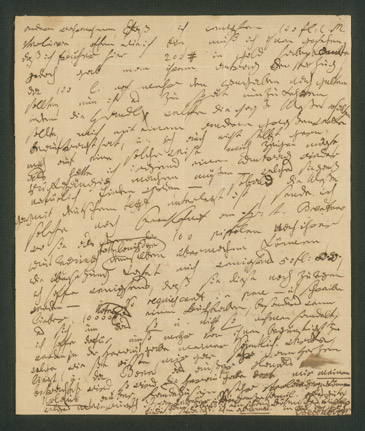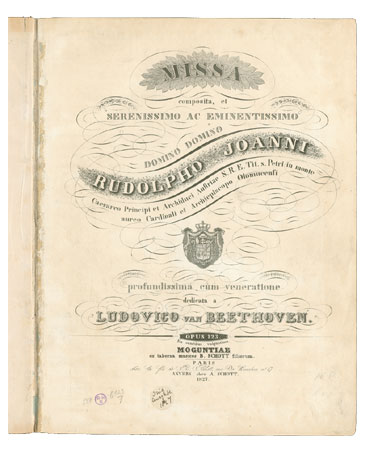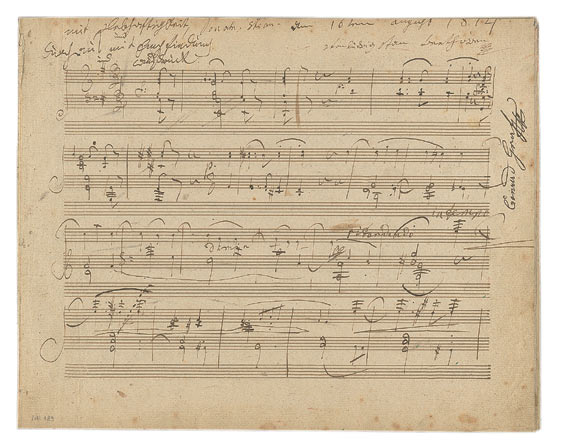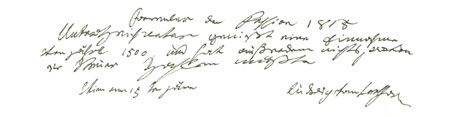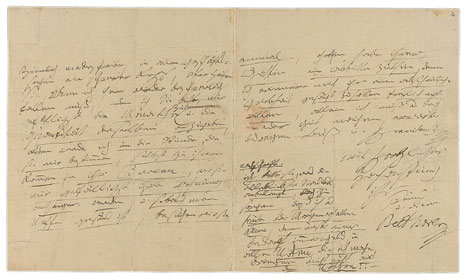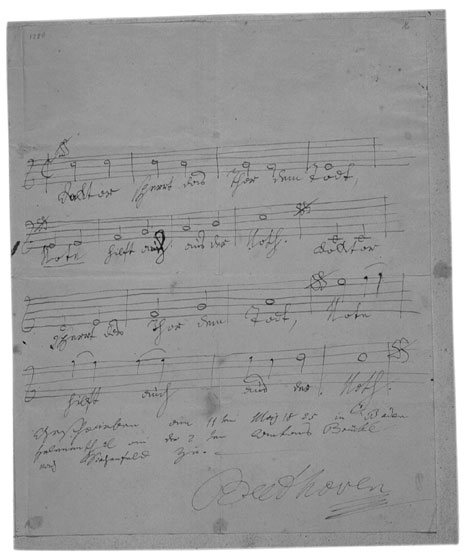Vom Hofmusiker zum freischaffenden Künstler
Als Sohn eines Hofmusikers und Enkel des ehemaligen Hofkapellmeisters trat Beethoven schon früh als Hofmusiker in
die Dienste des Kurfürsten von Köln. Eine von seinem Vater damals angestrebte Wunderkind-Karriere à la Mozart
ließ sich nicht verwirklichen. Bereits mit 12 Jahren vertrat der junge Musiker den Hoforganisten Christian
Gottlob Neefe. Die Neuordnung der Hofkapelle im Zuge des Regierungswechsels von Kurfürst Maximilian Friedrich zu
Maximilian Franz brachte dem 14-jährigen dann eine Festanstellung als zweiter Hoforganist. Seine Bezüge beliefen
sich auf 150 Gulden, sein Vater erhielt 300 Gulden. 1787 schickte sein Dienstherr Beethoven zu Studienzwecken
nach Wien; da seine Mutter schwer erkrankte, musste er jedoch bereits nach zwei Wochen nach Bonn
zurückkehren.
Christian Gottlob Neefe (1748-1798)
Orgelspieltisch, "Beethovens Orgel"
Vom Hofmusiker zum freischaffenden Künstler
Die ersten Wiener Jahre
1792 begab sich Beethoven erneut zu einem Studienaufenthalt nach Wien, von dem er nie wieder nach Bonn
zurückkehren sollte. Vor seiner Abreise schrieb ihm einer seiner wichtigsten Bonner Förderer, Graf von
Waldstein, das berühmt gewordene Diktum "Durch ununterbrochenen Fleiß erhalten Sie: Mozart's Geist aus
Haydens Händen" ins Album. Der Kurfürst beurlaubte Beethoven und stattete ihn mit einem Stipendium von
100 Reichstalern aus.
Ludwig van Beethoven, 1802
In Wien knüpfte Beethoven schnell gute Kontakte und führte sich erfolgreich in die kunstliebenden
aristokratischen Kreise der Musikmetropole ein. In seinem Reisetagebuch notierte er auch noch seine Ausgaben in
der ersten Zeit in Wien. Für sein Zimmer zahlte er 14 Gulden monatlich, für "essen mit dem wein" notierte er um
16 Gulden. Da der Betrag, den der Bonner Kurfürst zahlte, 150 Gulden entsprach, konnte Beethoven von diesem Geld
also nicht leben, noch nicht einmal die Mietkosten decken. Durch verschiedene Nebentätigkeiten wie Unterricht
und Auftritte in den adeligen Salons als Pianist etablierte er sich aber schnell als Künstler und erfuhr dann
später auch als Komponist Unterstützung durch den Adel.
Fürst Karl von Lichnowsky (1756-1814)
Fürst Karl von Lichnowsky setzte Beethoven im Jahr 1800 ein Jahresgehalt von 600 Gulden aus, das gezahlt werden
sollte, bis Beethoven ein sicheres Einkommen hätte. In einem Brief an seinen Bonner Freund Franz Gerhard Wegeler
berichtete Beethoven sehr optimistisch, wenn nicht gar euphorisch, von seinen derzeitigen Lebensumständen: "von
meiner Lage willst du was wissen, nun sie wäre eben so schlecht nicht, seit vorigem Jahr hat mir Lichnowski
[...] eine sichere Summe von 600 fl. ausgeworfen, die ich, so lang ich keine für mich passende Anstellung finde,
ziehen kann, meine Komposizionen tragen mir viel ein [...] auch habe ich auf jede Sache 6, 7 Verleger [...] ich
fodere und man zahlt [...] auch bin ich ökonomischer als sonst, sollte ich immer hier bleiben, so bringe ichs
auch sicher dahin daß ich jährlich immer eine[n] Tag zur Akademie erhalte". Beethoven hatte am 2. April 1800 das
erste Konzert zu seinen eigenen Gunsten im renommierten Hofburgtheater gegeben. Obwohl er auch damals schon
großen Wert auf seine Unabhängigkeit legte, strebte er trotzdem mehrfach eine gut dotierte sichere Anstellung
an. Nachdem er schon 1803/1804 als Opernkomponist und Kapellmeister beim Theater an der Wien angestellt war,
bewarb er sich Ende 1807 bei der k.k. Hoftheaterdirektion. Allerdings forderte er die horrende Summe von 2400
Gulden (Salieri verdiente als Hofkapellmeister lediglich 1200 Gulden) sowie die Einnahmen aus der dritten
Aufführung der Oper, die er jährlich komponieren würde. Gegen ein weiteres honorarfreies Werk wollte er einmal
jährlich die Räumlichkeiten für ein Konzert zu eigenen Gunsten nutzen. Das Anstellungsgesuch wurde
abgelehnt.
Beethovens Arbeitsstipendium von Fürst Lobkowitz, Fürst Kinsky und Erzherzog Rudolph
Abschluss des "Rentenvertrags"
Im Herbst 1808 erhielt Beethoven ein Angebot von Napoleons Bruder, König Jérome Bonaparte von Westfalen, für das
großzügige Gehalt von 600 Dukaten jährlich als Kapellmeister an den Kasseler Hof zu kommen. Beethoven streute
diese Nachricht in Wien und ließ auch verlautbaren, dass er gewillt sei, das Angebot anzunehmen. Ignaz von
Gleichenstein und die Gräfin Erdödy setzten sich daraufhin dafür ein, den Komponisten in Wien zu halten.
Beethoven wurde aufgefordert, die Bedingungen zu nennen, unter denen er in Wien bleiben würde. Gleichenstein
formulierte daraus einen Vertragsentwurf. Beethoven forderte neben 4000 Gulden jährlich auch die Möglichkeit zu
Kunstreisen, den Titel eines kaiserlichen Kapellmeisters sowie die Zusage, einmal jährlich ein Konzert zu seinen
Gunsten im Theater an der Wien veranstalten zu können.
Es gelang tatsächlich, drei Mäzene zu finden, die die geforderte Summe zu unterschiedlichen Anteilen
aufbrachten. Der Entwurf wurde auf das Wesentliche reduziert und als so genannter "Rentenvertrag" oder
"Stiftungsbrief" einige Tage vor dem angegebenen Datum von den Fürsten Kinsky und Lobkowitz sowie Erzherzog
Rudolph unterzeichnet. Sie verpflichteten sich, Beethoven bis zu einer festen Anstellung bzw. falls keine solche
erfolgen sollte, lebenslang jährlich den Betrag von 4000 Gulden in Bancozetteln (Papiergeld) zu zahlen, um ihn
materieller Sorgen zu entheben. "Da es aber erwiesen ist, daß nur ein so viel [als] möglich sorgenfreyer Mensch,
sich einem Fache allein widmen könne, und diese, vor allen übrigen Beschäftigungen ausschlüssliche Verwendung,
allein im Stande sey, grosse, erhabene, und die Kunst veredelnde Werke zu erzeugen; so haben Unterzeichnete den
Entschluß gefaßt, Herrn Ludwig van Beethoven in den Stand zu setzen, daß die nothwendigsten Bedürfnüsse ihn in
keine Verlegenheit bringen und sein kraftvolles Genie dämmen sollen." Im Gegenzug verpflichtete Beethoven sich,
in Wien oder zumindest in Österreich zu bleiben.
Beethovens Arbeitsstipendium von Fürst Lobkowitz, Fürst Kinsky und Erzherzog Rudolph
Dank an die Mäzene
Aus Dankbarkeit widmete Beethoven seinen Gönnern verschiedene Werke. Erzherzog Rudolph, jüngster Sohn Kaiser
Leopolds II. und Bruder von Kaiser Franz, war Klavier- und Kompositionsschüler Beethovens und wurde zum
wichtigsten Förderer des Komponisten. Er war ein hervorragender Pianist und komponierte zuweilen auch selbst.
Beethoven widmete ihm weit mehr Kompositionen als irgendjemandem anderen. Die Erzherzog Rudolph zugedachte
Klaviersonate op. 81a ("Les Adieux") thematisiert in ihren drei Sätzen konkret den Weggang, die Abwesenheit und
die Rückkehr des Erzherzogs von bzw. nach Wien im Zuge der Kriegsereignisse 1809. Auf das Titelblatt der
Handschrift schrieb Beethoven eigenhändig: "Das Lebe Wohl / Wien am 4ten May 1809 / bei der Abreise S[einer]
Kaiserl[ichen] Hoheit / des Verehrten Erzherzogs / Rudolf." Sie ist also sozusagen ein Stück "komponierte
Biographie".
Dem Fürsten Lobkowitz dedizierte Beethoven neben der 5. und 6. Sinfonie (deren Widmung dieser sich mit Graf
Rasumowsky teilte) auch sein neues Streichquartett op. 74. Er komponierte das Stück im Sommer und Herbst 1809
während seines Aufenthalts in Baden bei Wien.
Erzherzog Rudolph von Österreich (1788-1831)
Streichquartett Es-Dur op. 74
Glaubte Beethoven nun, durch das Stipendium eine sichere Basis gefunden zu haben, auf der er sich, aller
materiellen Sorgen enthoben, ganz seiner Kunst widmen konnte, so belehrte ihn die Wirklichkeit schnell eines
Schlechteren. Zur Finanzierung der Napoleonischen Kriege wurden große Mengen Geld benötigt. So entschloss man
sich, wie schon während des Siebenjährigen Krieges, das Papiergeld zu vermehren. Der Gesamtumlauf der Scheine
stieg von 74 Millionen im Jahr 1797 auf 1061 Millionen 1811. Längst war die Schere zwischen den
Stadt-Banco-Zetteln (Papiergeld) und den zu ihrer Deckung ursprünglich vorgesehenen Silbermünzen so weit
auseinandergeklafft, dass man die Einwechselbarkeit der Scheine gegen Metallgeld hatte aufgeben müssen. Die
Banco-Zettel verloren ständig an Kaufkraft, eine allgemeine Teuerung und Verelendung breiter
Bevölkerungsschichten war die Folge.
Entsprach Beethovens "Gehalt" von 4000 Gulden B.Z. (Banco-Zettel, Papiergeld) bei Abschluss des Vertrags im
Frühjahr 1809 schon nur 1620 Gulden C.M. (Conventionsmünze, Silberwährung) - die 600 Dukaten aus Kassel hätten
rund 2700 Gulden C.M. ausgemacht - so waren es im August 1810 nur noch 890 Gulden, im Dezember 1810, als der
niedrigste Kurs mit fast 10:1 erreicht war, gerade noch 416 Gulden.
Klaviersonate Es-Dur op. 81a
Die österreichische Regierung musste schließlich erkennen, dass ein Staatsbankrott unabwendbar wurde und auf
Anraten des Hofkammerpräsidenten Graf Wallis wurde 1811 zu dem Radikalmittel gegriffen, das Papiergeld zu
entwerten. Die bald auch "Bankrottpatent" genannte Verfügung Kaiser Franz I. vom 20. Februar 1811 bestimmte eine
Herabsetzung der umlaufenden Banco-Zettel auf ein Fünftel ihres Nominalwertes. Die am 15. März in Kraft tretende
Verordnung sah den Umtausch in so genannte "Einlösungsscheine" der neuen "Wiener Währung" (W.W.) bis zum 31.
Januar 1812 vor.
Um den Verlust für die bis zum Inkrafttreten der Verfügung abgeschlossenen privatrechtlichen Verträge, also
Renten, Pensionen etc., nicht allzu krass ausfallen zu lassen, wurde der neue Wert solcher Zahlungen gemäß des
bei Abschluss des Vertrags herrschenden Banco-Zettel-Kurses berechnet. Hierfür wurde eine Skala aufgestellt. Der
Wert für März 1809 betrug 248, d.h. der bei Vertragsabschluss festgelegte Betrag wurde als das 2,48-fache der
nun zu zahlenden Summe angesehen.
Beethovens Arbeitsstipendium von Fürst Lobkowitz, Fürst Kinsky und Erzherzog Rudolph
Probleme mit der Auszahlung I
Beethoven versuchte nun, bei seinen Stiftern zu erwirken, dass eine Umrechnung nach der Skala nicht vorgenommen
werde, sondern die jeweilige Summe statt in Banco-Zetteln voll in Einlösungsscheinen ausgezahlt würde. Obwohl
laut Beethovens Beteuerungen alle drei zunächst ihr Einverständnis erklärten, erhielt er de facto in der
Folgezeit nur von Erzherzog Rudolph den vollen Betrag.
Quittung für die Hauptkasse des Erzherzogs Rudolph
Infolge der äußerst gespannten wirtschaftlichen Verhältnisse hatte sich Fürst Lobkowitz hoch verschuldet. Seit
September 1811 blieben seine Zahlungen aus. Am 1. Juni 1813 musste sein Vermögen zunächst unter eine
"freundschaftliche Administration", ein halbes Jahr später schließlich unter staatliche Administration gestellt
werden. Hierdurch wurden dem Fürsten alle Dispositionsrechte über sein Eigentum aberkannt; er musste seine
Kapelle auflösen und Wien verlassen.
Gerichtsakten zum Prozess gegen Fürst Lobkowitz
In Anbetracht des drohenden Konkurses reichte Beethoven beim niederösterreichischen Landrecht Klage gegen den
Fürsten ein, der in erster Instanz stattgegeben wurde. Am 22. Oktober 1813 wurde Lobkowitz zur Zahlung der
rückständigen Pension sowie der künftigen in vollem Nennwert in Wiener Währung verurteilt. Die gegnerische
Partei legte beim niederösterreichischen Appellationsgericht Berufung ein und Fürst Lobkowitz wurde am 22. März
1814 die Möglichkeit eingeräumt, durch Ablegung eines "Haupteides" Beethovens Beweismittel, eine mündliche
Zusage des Fürsten, zu entkräften. Daraufhin wandte sich die lobkowitzische Seite im Hofrekurs an den Kaiser,
der jedoch die Verfügung des Appellationsgerichts bestätigte. Da Fürst Lobkowitz sich weigerte, vor Gericht
einen Eid abzulegen, trat am 19. April 1815 das ursprüngliche Urteil in Kraft. Bis Ende August 1815 hat
Beethoven dann die rückständige Summe in drei Raten erhalten.
Beethovens Arbeitsstipendium von Fürst Lobkowitz, Fürst Kinsky und Erzherzog Rudolph
Probleme mit der Auszahlung II
Auch die Zahlungen aus der Kinskyschen Kasse musste Beethoven erst in komplizierten Gerichtsverfahren einklagen.
Obwohl Fürst Kinsky im Januar 1812, also bevor Beethoven mit seiner Bitte um volle Auszahlung an ihn trat, an seine
Wiener Kasse die Anweisung gegeben hatte, Beethovens Gehalt nach der Skala umgerechnet auszuzahlen, trat eine
längere Verzögerung ein. Am 2. November 1812 starb der Fürst an den Folgen eines Reitunfalls. Mit der Bitte um volle
Ausstellung in Einlösungsscheinen und dem Hinweis auf die ausstehenden Zahlungen wandte sich Beethoven nun an die
Fürstin Karoline Kinsky, die jedoch nicht ohne die Zustimmung des Mitvormunds und der Vormundschaftsbehörde
entscheiden konnte. Letztendlich wurde am 18. Januar 1815 durch die Prager Landrechte der Kinsky-Anteil rückwirkend
ab dem Todestag des Fürsten auf 1200 Gulden W.W. gerichtlich festgelegt.
Die Quittung bezieht sich auf die erste der Zahlungen nach der Entscheidung der Prager Landrechte. Das Stipendium
sollte in zwei halbjährlichen Raten zu je 600 Gulden W.W. ausgezahlt werden. Beethoven musste auf offiziellem Papier
in Form eines Stempelbogens eine Quittung erstellen, die außer dem Siegel und der eigenhändigen Unterschrift auch
eine Beglaubigung darüber enthalten musste, dass es sich bei dem Empfänger um eine lebende Person handelt
(ausgestellt von einem Pfarramt als standesamtlicher Instanz).
Quittung für die Fürstlich Kinskysche Hauptkasse
Die Zahlungen aus der Kinskyschen Kasse erfolgten häufiger mit einiger Verspätung. Zur Beschleunigung
bevollmächtigte Beethoven seinen Rechtsanwalt Nepomuk Kanka, der ihn schon im Gerichtsverfahren unterstützt hatte.
Ursprünglich sollte die Auszahlung über das Prager Bankhaus Ballabene erfolgen, aber im beiliegenden Brief an Kanka
schrieb Beethoven: "Pasqualati sagte heute nach einem Monath und 6 Tägen, daß das Haus Ballabene zu groß für d.g.
sey, daher muß ich schon Ihre Kleinheit (so wie ich mir auch nichts daraus mache, so klein zu seyn Andern zu dienen)
in Anspruch nehmen."
Vollmacht für Kanka in Prag
Beethoven informierte Kanka am 1. Mai 1816 auch über sein Vorhaben, der Fürstin Kinsky ein Werk zu widmen: "Der
Fürstin Kinsky ist eben eine dedication auf der Post von mir an selbe übergeben worden, hiezu werde ich denn noch
einen Brief nachsenden, worin ich in der Respektvollsten Manier um das anhalten werde, was mir rechtsmäßig zukommt".
Ein solcher Brief ist zwar nicht erhalten, möglicherweise auch nie geschrieben worden. Beethoven muss sich nach den
langwierigen Verhandlungen um die Höhe seines Gehaltes eigentlich darüber im Klaren gewesen sein, dass ein
neuerlicher Versuch ebenfalls zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. So beließ er es wohl bei dem für sich
sprechenden Titel "An die Hoffnung".
Lebenshaltungskosten in Beethovens Wien
Zusammensetzung und Bedarf
Die Verhältnisse in Beethovens Wien waren deutlich andere als heute und lassen sich deshalb nicht unmittelbar
vergleichen. Vielmehr muss man für ein objektives Bild Beethoven in seiner eigenen Zeit sehen. Die
Lebenshaltungskosten setzten sich im Wesentlichen zusammen aus den Ausgaben für Lebensmittel, Miete und
Kleidung. Der Zeitgenosse Johann Pezzl kam in seiner "Neuen Skizze von Wien" für 1804 zu dem Ergebnis, dass der
Mindestbedarf für "einen Mann, der einzeln, ohne Glanz, ohne öffentliches Amt, ganz in der Stille für sich
selbst leben, und nur mit Leuten vom Mittelstande umgeben will", bei 967 Gulden lag. Allerdings erwähnte er
weiter "Will der Mann doch von Zeit zu Zeit, wie natürlich, die Spectakeln besuchen, sich ein Buch anschaffen,
irgend eine öffentliche oder private Ergötzlichkeit mitmachen, so kömmt er unter 1200 fl. jährlich nicht mehr
zurechte." Um eine Vergleichbarkeit mit heutigen Lebenshaltungskosten zu erhalten, muss man diese Ausgaben für
das "Vergnügen" natürlich einbeziehen. Aber auch dann entfielen immer noch 41% auf Lebensmittel (ohne
"Freizeitvergnügen" waren dies sogar 52%), wogegen wir heute gerade einmal ein Fünftel für Lebensmittel
aufwenden. Auch Kleidung war deutlich teurer als heute, damals 19%, heute nur 6%. Entgegengesetzt entfällt heute
mit 37% der größte Teil auf Wohnung mit Nebenkosten, damals waren das nur 14%. Rechnet man das Budget unter
Zuhilfenahme der Entwicklung der Lebensmittel- und Mietkosten für das Jahr 1809 hoch, so ergibt sich ein Wert
von 1600 Gulden. Die Unterstützung, die Beethoven anfänglich von seinen Mäzenen bekam, betrug also fast das
Zweieinhalbfache des Budgets des "Mannes vom Mittelstand". In den extremsten Jahren 1816 und 1817 hingegen lag
die Rente mit 3400 Gulden W.W. sogar unter dem Pezzl-Budget von ca. 3750 Gulden W.W.
Übersicht der Satzungen, Februar 1809
Die Aufstellung von Pezzl belegt also, warum gerade die Lebensmittelpreise so ausschlaggebend waren. Zeigen
zeitgenössische Darstellungen bereits für Beethovens erste Wiener Jahre einen deutlichen Preisanstieg der
Lebensmittel, so spitzte sich die Lage mit der Besetzung Wiens durch Napoleons Truppen im Mai 1809 weiter zu und
führte schließlich zu einer echten Versorgungsnotlage in der Stadt. In der zweiten Jahreshälfte stiegen die
Lebensmittelpreise um 50%. Die Preise für Mehl, Brot, Fleisch, Fisch, Kerzen, Seife, Bier und Brennholz waren in
Form von "Satzungspreisen" staatlich festgelegt. Als selbst diese Taxen erhöht wurden, gestaltete sich das Leben
immer schwieriger. Im Februar kostete ein Pfund Rindfleisch noch 18, im September schon 27 Kreuzer; alle anderen
Preise passten sich der Marktlage an und waren für die breite Bevölkerung kaum bezahlbar.
Auch Beethoven äußerte sich entsprechend. Um gegenüber seinem Leipziger Verleger Breitkopf & Härtel zu
begründen, warum er weiterhin auf dem geforderten Honorar in Silbermünze Konventionswährung für ein Werkpaket
bestehen musste, schrieb er: "Wir bezahlen jetzt 30 fl. für ein Paar Stiefel, 60 auch 70 fl. für einen Rock etc.
hol der Henker das ökonomisch-Musikalische - meine 4000 fl. waren voriges Jahr, ehe die Franzosen gekommen
etwas, dieses Jahr sind es nicht einmal 1000 fl. in Konvenzionsgeld". Zum Vergleich: 1792 notierte Beethoven für
Stiefel 6 Gulden, nun - 1810 - kosteten sie 30 Gulden, also das Fünffache.
Schriftlicher Dialog mit Haslinger
Die Lebensmittelkosten stiegen zwar schneller und unregelmäßiger an als die Mieten, aber auch die Mietpreise
waren der Inflation und Teuerung unterworfen. 1816 zahlte Beethoven dem Grafen Lamberti eine mehr als zehnmal so
hohe Miete (1100 Gulden W.W., entsprechen 5500 Gulden B.Z.) wie die, welche er sechs Jahre zuvor im
Pasqualati-Haus bezahlte hatte (500 Gulden B.Z.).
Dass Beethoven sich in hauswirtschaftlichen Fragen oft beraten ließ, zeigt die ausgiebige diesbezügliche
Korrespondenz mit Nannette Streicher, Inhaberin und treibende Kraft einer der führenden Klavierbauwerkstätten
Wiens.
Der mit Beethoven befreundete Musikverleger Tobias Haslinger half ihm im Oktober 1817 beim Umzug von seinem
Sommerwohnsitz in die Stadtwohnung. Möglicherweise ließ Beethoven sich in diesem Zusammenhang über Tapeten und
Schubladenkommoden beraten.
Lebenshaltungskosten in Beethovens Wien
Ausgaben für Lebensmittel
Nach zwei vorausgegangenen Missernten erreichte die extreme Inflation und Teuerung 1817 einen zweiten Höhepunkt.
Viele Lebensmittelpreise hatten sich erneut verdoppelt oder sogar verdreifacht. Auch der Wiener Kongress hatte
Unsummen verschlungen. So erstaunt es nicht, dass Beethoven im Juni 1815 gegenüber Johann Peter Salomon die
Befürchtung äußerte, "daß mein Gehalt zum 2tenmal zu Nichts werde". Die Börse notierte zu der Zeit einen
Wechselkurs von 100 Gulden C.M. zu 400 Gulden 50 Kreuzer W.W. Erst in späteren Jahren, um 1820, stabilisierte
sich der Kurs bei 100 : 250.
Zwei Blätter aus einem Haushaltsbuch
Aufgrund seiner finanziellen Engpässe und des zunehmenden Misstrauens, welches durch seine Taubheit verstärkt
wurde, zwang Beethoven seine Haushälterinnen, über alle Besorgungen Buch zu führen. In diesen Haushaltsbüchern
wurden sowohl die einzelnen Posten als auch die dafür ausgegebenen Beträge verzeichnet. Beethoven kontrollierte
die Auflistungen, vermerkte, wie viel Geld er seiner Haushälterin gegeben und was er zurückerhalten hatte und
strich die Seite schließlich durch, zum Zeichen, dass sie bereits geprüft worden war.
Lebenshaltungskosten in Beethovens Wien
Klavierpreise
Kosten für den Neffen
Die abgebildete Preisliste nennt die Preise für Klaviere von Anton Moser, der zwar nicht zu den ersten, aber zu
den soliden, preiswerten Klavierbauern Wiens gehörte. Die unterschiedlichen Preise von 40 bis 80 Dukaten ergeben
sich aus dem verwendeten Furnier und dem Tonumfang: Kirschbaum war am billigsten, Mahagoni am teuersten. Der
Tonumfang betrug entweder vom Kontra-F bis g´´´ (5 Oktaven plus Sekunde) oder bis c´´´´ (5 ½ Oktaven). Bei
anderen renommierten Klavierbauern kosteten Flügel mit Mahagoni-Furnier und Bronzebeschlägen 100 Dukaten, in
einfacher Ausführung z.B. bei Nannette Streicher mindestens 66 Dukaten. Mitte der 1820er Jahre kosteten
Instrumente aus ihrer Werkstatt zwischen 80 Dukaten für einfache, flügelförmige Klaviere in Nussholz mit einen
Tonumfang von 6 Oktaven und 165 Dukaten für 6 ½ oktavige mit Mahagoni-Furnier und aufwändigen Beschlägen. Bei
anderen Klavierbauern waren einfache Tafelklaviere bereits für 33 Dukaten zu haben.
Beethoven hat gelegentlich Instrumente vermittelt bzw. ausgewählt. Er selbst musste aber wohl nie ein Instrument
käuflich erwerben. Als prominenter Pianist und Komponist konnte er auf Leihgaben und Geschenke renommierter
Klavierbauer zurückgreifen, die sich des Werbeeffektes sicher sein konnten.
Nach dem Tod seines Bruders Kaspar Karl im November 1815 übernahm Ludwig van Beethoven im folgenden Jahr die
Vormundschaft für seinen Neffen Karl. Am 10. Mai 1817 verglichen sich Beethoven und seine Schwägerin Johanna
über die Verlassenschaft des Bruders. Er einigte sich mit ihr, dass sie die Hälfte ihrer Witwenpension als
Beitrag zur Erziehung ihres Kindes abgeben sollte. Außerdem erhielt Karl 2000 Gulden W.W. aus dem Erbteil seines
Vaters. Die Witwe erhielt das Haus 121 in der Alservorstadt zum alleinigen Eigentum. Da das Verhältnis des
Komponisten zu seiner Schwägerin ausgesprochen belastet war, versuchte er immer wieder, die Mutter von der
Vormundschaft für ihr Kind auszuschließen. Es entbrannte ein langwieriger Rechtsstreit, der sich bis 1820
hinzog.
Neffe Karl van Beethoven (1806-1858)
Vertrag mit Johanna van Beethoven
Karl besuchte zunächst eine Reihe verschiedener Schulen, so auch das Institut des Cajetan Giannattasio del Rio.
Die Schulgebühren beliefen sich auf 275 Gulden W.W. im Quartal. An Ferdinand Ries, der in London ein
Benefizkonzert für ihn organisieren wollte, schrieb Beethoven am 8. Mai 1816: "mein Gehalt beträgt 3400 fl. in
Papier - 1100 Haußzins bezahle ich mein bedienter mit seiner Frau bis beynahe 900 fl. rechnen sie, was also noch
bleibt, dabey habe ich meinen kleinen Neffen ganz zu versorgen, bis jezt ist er im Institute dies kostet bis
1100 fl., u. ist dabey doch schlecht, so daß ich eine Ordentliche Haußhaltung einrichten muß, um ihn zu mir zu
nehmen - wie viel man verdienen muß um hier nur leben zu können". Später wohnte Karl dann vorübergehend bei
seinem Onkel und besuchte die Wiener Universität, bevor er 1825 an das Polytechnikum in Wien überwechselte.
Schließlich schlug er jedoch eine militärische Laufbahn ein.
Beethoven und seine Verleger
Seine Verkaufsstrategien
Die Honorare, die Beethoven von seinen Verlegern erhielt, waren wohl seine wichtigste Einnahmequelle. Seine
zunehmende Schwerhörigkeit raubte ihm ein wesentliches berufliches und finanzielles weiteres Standbein, nämlich
Auftritte als ausübender Künstler. So wurde er zu einem geschickten Verhandlungspartner und Taktierer. Als
Komponist wollte Beethoven frei und unabhängig bleiben und zeitlose Werke für ein internationales Publikum
schaffen; Auftragswerke bildeten die Ausnahme zur Regel. Allerdings bot er bedeutende Werke adeligen Mäzenen vor
der Drucklegung gegen ein Honorar für eine vorübergehende exklusive Nutzung von ca. 6 bis 12 Monaten an.
Anschließend wurde das Werk dann meist verschiedenen Verlegern angeboten, die dadurch in Konkurrenz zueinander
traten. Vereinbart wurden feste Einmalhonorare, die auch die weitergehende Nutzung über Übertragungen in
kleinere Besetzungen abdeckten. Am Umsatz gab es dann keine weitere Beteiligung. Nachdrucke gedruckter oder
Abschriften ungedruckter oder gedruckter Werke, die in professionellen Kopistenbüros erstellt und vertrieben
wurden, brachten dem Komponisten keinerlei Einnahme.
Die Verleger machten sicherlich größere Gewinne mit jenen Komponisten, die weit geringere Honorare erhielten und
beim Schreiben stets die Möglichkeiten einer breiten Käuferschicht im Auge behielten. Werke von Beethoven zu
verlegen hob allerdings Prestige und Renommée der Verleger, und so lohnte es sich zumindest über viele Jahre
gesehen (weil Beethovens Werke im Repertoire blieben und später hohe Neuauflagen möglich waren), auch, wenn das
Honorar für Beethoven oft mehr als die Hälfte der Gesamtkosten einer Druckausgabe ausmachte.
Brief an Breitkopf & Härtel vom 2. Januar 1810
Beethoven verkaufte 1809 dem Leipziger Musikverlag Breitkopf & Härtel, dem er einige Jahre "vor allen andern den
Vorzug" gab, ein Werkpaket bestehend aus dem Oratorium "Christus am Ölberg" op. 85, der Oper "Leonore" op. 72
und der Messe in C-Dur op. 86 für das Gesamthonorar von 250 Gulden C.M. Entgegen der Abmachung war ihm der
Betrag jedoch vollständig in Papiergeld angewiesen worden, dessen Kurs von Tag zu Tag weiter fiel. Deshalb
forderte er die Rücknahme der Banco-Zettel und Auszahlung in Silberwährung.
Einige Monate später verlangte Beethoven für ein weiteres großes Werkpaket (opp. 74 bis 86) 250 Dukaten. Als der
Verleger versuchte, ihn auf 200 Dukaten herunterzuhandeln, reagierte er mit folgenden Worten: "ich habe nicht
zum Endzweck, wie sie glauben, ein Musikalischer Kunstwucherer zu werden, der nur schreibt, um reich zu werden,
o bewahre, doch liebe ich ein Unabhängiges Leben, dieses kann ich nicht anders als ohne ein kleines Vermögen,
und dann muß das honorar selbst dem Künstler einige Ehre, wie alles was er unternimmt hiermit umgeben seyn muß,
machen, ich dörfte keinem Menschen sagen, daß mir Breitkopf und Härtl 200 # für diese Werke gegeben - sie als
ein Humanerer und Weit Gebildeterer Kopf als alle andern Musikalischen Verleger dörften auch zugleich den
Endzweck haben den Künstler nicht bloß nothdürftig zu bezahlen, sondern ihn vielmehr auf den weg zu leiten, daß
er alles das ungestört leisten könne, was in ihm ist, und man von außen von ihm erwartet -".
Holländischer Dukat avers
Eigentumsbestätigung und Quittung für Birchall
Beethoven bot seine Werke auch gleichzeitig mehreren Verlegern für die verschiedenen europäischen Märkte an,
geknüpft an die Bedingung, dass die Ausgaben gleichzeitig erscheinen mussten, damit kein Verleger Schaden
erlitt. Die Märkte waren relativ klar getrennt zwischen Österreich und einem politisch kleingliedrigen
Deutschland (mit Leipzig, Bonn, Berlin, Mainz) sowie Frankreich und England. An den Londoner Verleger Robert
Birchall trat er die Eigentums- und Verlagsrechte des Klavierauszugs der Schlachtensinfonie "Wellingtons Sieg
oder die Schlacht bei Vittoria" op. 91, des Klavierauszugs der 7. Sinfonie op. 92, des Klaviertrios op. 97 sowie
der Violinsonate op. 96 für das Vereinigte Königreich und Irland gegen ein Honorar von 130 holländischen Dukaten
ab. Der Wiener Verleger Steiner musste seine Ausgabe des Klavierauszugs der Schlachtensinfonie - eines der
wenigen Gelegenheitswerke, die in besonderem Maße auf Publikumsakzeptanz zielten - deshalb noch etwas
zurückstellen.
Beethoven und seine Verleger
Der Fall "Missa solemnis"
Die komplexesten und zugleich auch bedenklichsten Verkaufsbemühungen unternahm Beethoven ausgerechnet bei seiner
größten kirchenmusikalischen Komposition, der Missa solemnis, die er damals auch als sein bedeutendstes Werk
ansah.
Brief an Simrock vom 28. November 1820
Bereits im Februar 1820, einen Monat vor der Inthronisation seines Schülers Erzherzog Rudolph als Erzbischof von
Olmütz, zu der die Messe hätte ursprünglich erklingen sollen, aber letztlich fast drei Jahre vor ihrer
endgültigen Fertigstellung, einigte sich Beethoven mit seinem alten Bonner Kollegen Nikolaus Simrock auf ein
Honorar von 100 Louis d´or. Obwohl Simrock mehrfach betont, dass er den Wert des Louis d´or mit dem Friedrichs
d´or bzw. der Pistole gleichsetze (dessen Wert lediglich 7,5 Gulden C.M. entsprach), fühlte Beethoven sich
letztlich übervorteilt, da er selbst stets von 9 Gulden ausgegangen war. So hatte er sich denn auch von seinem
Freund Franz Brentano einen Vorschuss von 900 Gulden C.M. auf das Honorar geben lassen, den er erst drei Jahre
später in zwei Raten zurückzahlen konnte. Beethoven nahm nun parallel Verhandlungen mit den Verlegern Peters in
Leipzig und Artaria in Wien auf, denen weitere folgten. Schließlich wurde die Messe 1824 für 1000 Gulden C.M. an
den Verlag Schott in Mainz verkauft, gemeinsam mit der 9. Sinfonie, die 600 Gulden C.M. einbrachte.
Vor der Drucklegung bot Beethoven die Missa solemnis in von seinen eigenen Kopisten hergestellten Abschriften 28
europäischen Fürstenhöfen für jeweils 50 Dukaten an. 10 Bestellungen gingen ein. Dies brachte ihm einen
zusätzlichen Gewinn von 1650 Gulden C.M.
Beethoven als Konzertveranstalter
Wie damals durchaus üblich betätigte sich Beethoven auch als Konzertveranstalter. Benefizkonzerte zugunsten eines
Musikers oder Komponisten, die so genannten Akademien, waren jedoch immer mit einem hohen finanziellen Risiko
behaftet. In der Regel fungierte der Komponist, der seine neuen Werke aufführen oder der Virtuose, der seine
Fähigkeiten dem Publikum vorführen wollte, selbst als Veranstalter, was zu einer sehr beträchtlichen
zusätzlichen, oft als lästig und besonders mühsam empfundenen Arbeitsbelastung führte. Er musste sich um die
Zusammenstellung des Programms, die Musiker, die Bewerbung der Veranstaltung sowie den Kartenvorverkauf kümmern.
Außerdem musste ein geeigneter Raum - ein Theater oder ein Mehrzweckraum wie z.B. die Redoutensäle - angemietet
werden. Der erste öffentliche ausschließlich für Konzerte bestimmte Saal wurde erst 1831 durch die 1812
gegründete Gesellschaft der Musikfreunde erbaut.
Beethoven gelang es, für seine erste eigene Akademie am 2. April 1800 das "National-Hof-Theater nächst der Burg"
zur Verfügung gestellt zu bekommen. Hierbei gereichte ihm die Widmung seiner Klaviersonaten op. 14 im Jahre 1799
an die Frau des Direktors der beiden Hoftheater Josephine von Braun sicherlich zum Vorteil. Auf dem Programm
standen laut Anschlagzettel eine Sinfonie von Mozart, zwei Stücke aus Haydns "Schöpfung", ein Klavierkonzert von
Beethoven (vermutlich die Nr. 1, op. 15), sein Septett op. 20 und die 1. Sinfonie op. 21, außerdem eine freie
Fantasie auf dem Klavier. Solche langen Mischprogramme, bei denen zwischen die großen Instrumentalstücke kleine
Gesangsstücke eingestreut waren, waren damals üblich. Wahrscheinlich war das Konzert finanziell erfolgreich,
auch wenn Beethoven entgegen der sonst üblichen Gepflogenheiten nur Eintrittsgeld "wie gewöhnlich" verlangt
hatte. Der Optimismus, mit dem er sich im Juni 1801 gegenüber seinem Jugendfreund Franz Gerhard Wegeler äußerte,
indem er für seine Zukunft in Wien erwartete, jedes Jahr das Theater für eine Akademie zu erhalten, spricht
jedenfalls für einen solchen Erfolg. Letztendlich fanden jedoch in den verbleibenden 26 Wiener Jahren
tatsächlich nur acht Benefizkonzerte zu seinen Gunsten statt, wovon nur vier finanziell erfolgreich waren.
Allerdings waren diese Akademien wohl auch eine gute Gelegenheit für bei solchen Anlässen durchaus übliche
großzügige Dotationen des Adels.
Hofburgtheater in Wien um 1825
Anschlagzettel für die Akademie am 2. April 1800
Prominentestes Beispiel sind die Konzerte, die Beethoven während des Wiener Kongresses gab. Von September 1814
bis Juni 1815 waren die führenden Regenten Europas in Wien versammelt. In ihrem Gefolge befanden sich Diplomaten
und Aristokraten, es wurde ein ausladendes Programm mit Bällen, Opernaufführungen und Konzerten geboten. Nach
dem Erfolg des sinfonischen Schlachtengemäldes "Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria" op. 91, das
genau den patriotischen Nerv der Zeit getroffen hatte, nutzte Beethoven erneut die Gunst der Stunde und
komponierte in kürzester Zeit die bombastische Kantate "Der glorreiche Augenblick" op. 136 nach rein
kommerziellen Gesichtspunkten. Vor einer begeisterten Hörerschaft und den versammelten Staatsoberhäuptern wurde
dann am 29. November 1814 noch einmal "Wellingtons Sieg" sowie die 7. Sinfonie und die neue Kantate gegeben. Das
Konzert wurde am 2. Dezember zu Beethovens Gunsten und am 25. Dezember zugunsten des Bürgerspitals St. Marx
wiederholt. Die Ausgaben für die ersten beiden Veranstaltungen betrugen 5108 fl. W.W. Dass Beethoven im Jahre
1814 mit seinen Konzerten trotzdem mehr verdiente als in allen anderen Jahren zusammen, ist sicher nicht zuletzt
auch der Zarin von Russland zu verdanken. Die Wiener "Friedensblätter" vom 24. Dezember 1814 berichteten, dass
sie Beethoven mit einem "grossmüthigen Geschenk von 200 Dukaten" unterstützt habe.
"Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria" op. 91
"Der glorreiche Augenblick" op. 136
Widmungen und Auftragswerke
Mit der eigens für die Zarin von Russland komponierten Polonaise op. 89 wollte Beethoven sich möglicherweise für
ihre großzügige Unterstützung seiner beiden Akademien beim Wiener Kongress bedanken. Allerdings erhielt er von
ihr auch noch ein Widmungsgeschenk von 50 Dukaten. Außerdem honorierte sie die bereits 1803 erschienenen und
ihrem Mann, Zar Alexander I., gewidmeten Violinsonaten op. 30 nachträglich mit 100 Dukaten. Dies sind aber schon
die einzigen Widmungen, von denen bekannt ist, dass sie sich direkt in klingender Münze ausgezahlt haben, obwohl
Beethoven diese Absicht sicher auch mit einigen anderen Zueignungen verfolgt hatte.
Polonaise für Klavier C-Dur op. 89
Elisabeta Alexejewna, Zarin von Russland (1779-1826)
Für die Widmung der den englischen Sieg verherrlichenden Schlachtensinfonie "Wellingtons Sieg oder die Schlacht
bei Vittoria" op. 91 an den Prinzregenten von England, späterer König George IV., erhoffte sich Beethoven
sicherlich eine glänzende Honorierung. Zeit seines Lebens erhielt er jedoch keinerlei Anerkennung dafür, obwohl
er auch später noch zahlreiche Versuche unternahm, den englischen König auf diese Unterlassung hinzuweisen. Für
die Widmung der 9. Sinfonie op. 125 an den preußischen König Friedrich Wilhelm III. hatte sich Beethoven die
Verleihung eines Ordens erhofft, erhielt aber lediglich einen wohl minderwertigen Ring und ein nüchternes
Dankschreiben. Trotzdem profitierte er von solchen Widmungen, da diese in den Augen der Öffentlichkeit den Rang
eines Werkes unterstrichen.
Viele Widmungen an seine Mäzene sprach Beethoven sicherlich in erster Linie aus Dankbarkeit aus. Eine Zueignung
war nicht nur für ihn selbst positiv, indem er seine Verehrung öffentlich zeigen konnte, sondern auch für den
Geehrten, der sich mit "seinem" Werk in der Öffentlichkeit schmücken konnte. Zahlenmäßig überwiegen die
Widmungen an seine adeligen Gönner weit jene aus rein freundschaftlicher Verbundenheit.
Violinsonate c-Moll op. 30 Nr. 2
Die wenigen Auftragswerke komponierte Beethoven für adelige Gönner (Streichquartette opp. 127, 132 und 130 für
Fürst Galitzin, Messe op. 86 für Fürst Nikolaus II. Esterházy), Musikgesellschaften (9. Sinfonie für die
Londoner Royal Philharmonic Society), Theater (z.B. die Schauspielmusiken opp. 113 und 117 für das Theater in
Pest) und Verleger (z.B. die Volksliedbearbeitungen für den schottischen Verleger George Thomson). Einige
Auftragswerke verwirklichte Beethoven nicht. Hier ragt ob der Höhe des Honorars der Auftrag der Gesellschaft der
Musikfreunde in Wien, ein Oratorium zu Carl Bernards Text "Der Sieg des Kreuzes" zu schreiben, heraus. Trotz
einer Anzahlung von 400 Gulden W.W. und einem vereinbarten Honorar von 300 Dukaten führte Beethoven nur eine
kurze Skizze aus. Er konnte sich mit dem Textbuch nicht anfreunden. Dieses Beispiel zeigt in aller Deutlichkeit,
dass letztlich die Kunst, nicht das Geld seine Welt regierte.
Beethovens Vermögensverhältnisse
Verleger als "Bankersatz"
Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen kam Beethoven immer wieder in Geldverlegenheiten. Fielen die
Zahlungen seiner Mäzene ab 1811 über drei Jahre fast vollständig weg, so entsprachen sie 1815, als sie endlich
wieder regelmäßig aufgenommen wurden, in keiner Weise der Kaufkraft von 1809. Die Rente konnte also ihren
ursprünglichen Zweck, den Komponisten jeglicher Sorge um alltägliche Geldnöte zu entheben, zumindest zeitweise nicht
erfüllen. Er musste immer wieder Darlehen bei verschiedenen Verlegern, aber auch bei Freunden wie den Brentanos und
bei seinem Bruder Johann aufnehmen.
Als sein Bruder Kaspar Karl 1813 schwer an Tuberkulose erkrankte, half Beethoven ihm mit einem Darlehen aus. Da es
nicht zurückgezahlt werden konnte, erhielt er den Betrag schließlich von seinem Verleger Sigmund Anton Steiner und
trat die Schuldforderung an diesen ab. Beethoven verpflichtete sich für den Fall, dass die vereinbarten
Rückzahlungstermine nicht eingehalten werden sollten, Steiner eine "ganz neue noch nirgend im Stich erschienene
Claviersonate" als Ausgleich, also unentgeltlich, zu überlassen sowie das Vorkaufsrecht für mehrere Werke zu
garantieren. Beethoven entschied sich für die Klaviersonate e-Moll op. 90, die somit eine Schuldentilgung eigener
Art darstellt.
Klaviersonate e-Moll op. 90
In den folgenden Jahren diente der Verleger Beethoven dann immer wieder als "Bankersatz", indem der Komponist
verschiedentlich Darlehen aufnahm, aber auch Gelder gewinnbringend anlegte. Am 16. Juli 1816 schrieb er an Steiner:
"sie sehn, daß ich vollkommenes Zutrauen in Sie seze, ich bitte sie nun Freundschaftlich Sorge zu tragen, daß mir
dieses mein einziges Kapital (kleines) so viel als möglich trage, u. eben so sicher als möglich". Es handelte sich
um einen Betrag von 4000 Gulden C.M., den Steiner zu 8% verzinste. Die Herkunft des Geldes ist unklar. Die Vermutung
liegt jedoch nahe, dass es sich um die Gewinne der Akademien von 1814 und die großzügigen Geschenke der Zarin
handelte.
Am 1. Juni 1816 wurde die "Privilegirte oesterreichische National-Bank" als unabhängige Aktiengesellschaft
gegründet. Mit dem Ziel der Währungskonsolidierung wurde das Papiergeld der Wiener Währung eingezogen und in dem
festgesetzten Verhältnis von 2,5 : 1 in neue Banknoten der ursprünglichen Conventions-Münze umgetauscht. Um 1820
hatte sich die Währung stabilisiert. Beethovens Arbeitsstipendium betrug nun 1360 Gulden, das entsprach ungefähr dem
Jahresgehalt eines Kapellmeisters. Die Musiker der Hofkapelle bekamen 400 bis 700 Gulden, was in etwa dem Gehalt
eines höheren Lehrers entsprach (die Musiker erzielten zusätzliche Nebeneinkünfte durch Unterricht und private
Aufführungen). Mittlere Beamte verdienten über 1000 Gulden, Beethovens Haushälterin bei freier Kost und Logis 129
Gulden.
In seiner Steuererklärung vom 15. Januar 1818 gab Beethoven als Einkommen lediglich 1500 Gulden W.W. an, das
entsprach dem Anteil von Erzherzog Rudolph an seinem Stipendium. Alle anderen Einkünfte aus dem Verkauf seiner Werke
und auch die Anteile der Fürsten Kinsky und Lobkowitz unterschlug er also. Die Klassensteuer war eine Vorstufe der
heutigen Einkommenssteuer und wurde seit 1800 erhoben. Ab 1802 hatten die Steuerpflichtigen ihre Einteilung in die
Steuerklassen entsprechend ihres Einkommens selber vorzunehmen und hierzu eine Erklärung abzugeben. Beethoven
verkürzte die offizielle Formulierung stark.
Beethovens Steuererklärung 1818
Beethovens Vermögensverhältnisse
Von Noten und Nöten
Beethoven forderte sein bei Steiner angelegtes Kapital nach drei Jahren zurück - ohne dass der Verleger Beethovens
Schulden abzog - und kaufte am 13. Juli 1819 davon acht Bankaktien der Oesterreichischen Nationalbank. Nachdem
verschiedene vereinbarte Termine für die Darlehensrückzahlungen abgelaufen waren, mahnte Steiner Beethoven Ende 1820
höflich, aber bestimmt an. Der Komponist hatte sich wohl bitter über den allerdings vorher ordnungsgemäß
festgelegten Zinssatz von 6% beklagt, der sogar unter dem Festzins für Beethovens Kapitalanlage lag.
"Mit Ihrer Aeusserung über meine Ihnen gesandte Rechnung bin und kann ich nicht zufrieden seyn; - denn ich habe
Ihnen an Interessen für baar darliehenes Geld 6% berechnet, wogegen ich Ihnen für Ihr bey mir liegen gehabtes Geld
8%, und diese vorhinein pünktlich, und auch Ihr Capital selbst prompt bezahlt habe. - Was also dem einen Recht ist,
muß dem Anderen billig seyn; zudem bin ich nicht in dem Falle, Gelder ohne Zinsen ausleihen zu können. - Ich habe
Ihnen als Freund in der Noth gedienet, ich habe auf Ihr Ehrenwort gebaut und geglaubt, und ich bin weder zudringlich
gewesen, noch habe ich Sie auf eine andere Art jemals geplagt, und muß daher wider die mir gemachten Vorwürfe
feyerlich protestiren. - Wenn Sie bedenken, daß mein Ihnen gemachtes Darlehen zum Theil schon in's fünfte Jahr
gehet, so werden Sie sich selbst bescheiden, daß ich nichts weniger, als ein zudringlicher Gläubiger war; ich würde
Sie auch jezt noch schonen und in Geduld abwarten, wenn ich auf Ehre, dermalen nicht selbst bey meinen
Unternehmungen Baarschaft höchst nothwendig hätte. - Wäre ich weniger überzeugt, daß Sie wirklich im Stande sind,
mir nun auch in der Noth Ihren Beystand leisten, und Ihr Ehrenwort halten zu können, ich würde, so schwer es mich
auch ankämme, noch recht gerne einige Zeit in Geduld stehen; allein wenn ich rückdenke, daß ich Ihnen selbst vor 17
Monaten baare f 4000 - Cmünz oder f 10000 - W.W. als Capital rückbezahlte, und bey dieser Rückzahlung auf Ihr
Ersuchen meine Gegenforderung nicht gleich damals abgezohen habe, so muß es mir nun doppelt schmerzlich fallen, daß
ich bey all meinem guten Willen und aus lauter Vertrauen auf Ihr Ehrenwort nun in Verlegenheit bin. - Ein Jeder weiß
am besten wo ihn der Schuh drückt, und in diesem Falle bin auch ich; daher beschwöre ich Sie wiederhollt, mich nicht
im Stiche sizen zu lassen, und Mittel auszufinden, meine Rechnung so schnell als möglich zu saldieren. -"
Brief Steiners an Beethoven vom 29. Dezember 1820
Beethoven merkte seine Überlegungen zu Herkunft und Zusammensetzung der Schulden an, die insgesamt 2420 Gulden W.W.
betrugen:
"die 1300 fl. w.w. sind wahrscheinlich 1816 oder 17 aufgenommen worden. - die 750 fl. w.w. noch später vieleicht
1819 - die 300 fl. sind schulden welche ich für die Frau. v. Beethoven vi - - de übernommen u. auch nur einige Jahre
betragen können - die 70 fl. dörften auch 1819 für mich bezahlt worden seyn."
Der erste Posten ist der Kredit, den Beethoven am 4. Mai 1816 erhalten hatte, der zweite das Darlehen vom 30.
Oktober 1819. Die 70 Gulden sind vielleicht mit einem Betrag von 72 Gulden in Verbindung zu bringen, den Steiner für
Beethoven im August 1816 an Bernard ausgezahlt hatte. Der letzte Posten von 300 Gulden entspricht ungefähr einer
Zinsschuld Johanna van Beethovens aus dem Jahre 1818. Beethoven schrieb ihr am 8. Januar 1824, dass er diese Schuld
abbezahlt habe.
Zur Tilgung der Schulden notiert Beethoven: "Nb: Zur bezahlung kann angewiesen werden jährl. 1200 fl. in
halbjährigen raten. -" Steiner hatte also insgesamt 520 Gulden W.W. an Zinsen zugeschlagen (1200 fl. C.M.
entsprechen 3000 fl. W.W.). Letztendlich musste Steiner bis zum Sommer 1824 auf die vollständige Rückzahlung der
gewährten Darlehen warten.
Brief an Salzmann, um den 8. Februar 1823
Das Zitat, das dieser Ausstellung den Titel gab, ist einem Brief Beethovens aus dem Jahre 1823 an Franz Salzmann,
den damaligen Oberbuchhalter der "Privilegierten Oesterreichischen Nationalbank" in Wien, entnommen. Beethoven
schuldete seinem Schneider 100 Gulden, dieser hatte ihm bereits mit einer Klage gedroht. Außerdem wollte er seinem
Freund Franz Brentano zumindest einen Teil des Geldes zurückzahlen, das dieser ihm drei Jahre zuvor als Vorschuss
auf das zu erwartende Honorar für die Missa solemnis geliehen hatte. Bevor Beethoven nun eine seiner Aktien erneut
belieh, wollte er sich die fällige Dividende auszahlen lassen. Deshalb schrieb er an Salzmann: "ich bedarf aber
wieder ihrer Hülfe, denn ich kann eben nicht mehr in der Welt als einige Noten so ziemlich niederschreiben, in allen
Geschäftssachen ein schwerer Kopf, verzeihen Sie, wenn ich ihnen wieder beschwerlich fallen muß, indem ich Sie
bitte, mir gefälligst die Monate zu benennen u. die Quantität derselben anzugeben." Und als "Nachschrift. Ich bitte
sie, was die allerliebste Dividende anbelangt, doch zu sorgen, daß ich es heute oder Morgen erhalten kann, denn
unser einer bedarf immer Geld u. alle Noten, die ich mache, bringen mich nicht aus den Nöthen!!"
Kanon "Doktor, sperrt das Tor dem Tod", WoO 189
Beethoven verwendete dieses geistreiche Wortspiel zwischen Musik-Note und der Not zu verschiedenen
Gelegenheiten, so auch in dem Kanon, den er im Mai 1825 nach der Genesung von schwerer Krankheit seinem behandelnden
Arzt Dr. Anton Braunhofer schickte: "Doktor, sperrt das Tor dem Tod - Note hilft auch aus der Not". Braunhofer hatte
Beethoven um "einige unbedeutende Noten" gebeten, wichtig war ihm allein Beethovens Handschrift. Sind die Nöte im
Salzmann-Brief eindeutig finanzieller Natur, so hat die "Not" hier eine doppelte Bedeutung: einerseits hilft ihm das
Komponieren - die Note - aus der finanziellen Not, andererseits aber auch aus der durch die lange Krankheit
verursachten seelischen Notlage.
Beethovens Vermögensverhältnisse
Seine Aktien
Aktie der Privilegirten oesterreichischen National-Bank, ausgestellt auf Ludwig van
Beethoven
Beethoven hinterlegte seine Aktien immer wieder als Sicherheiten für Darlehen, er belieh sie und
löste sie später wieder aus. Außerdem erhielt er natürlich die Dividende, 30 Gulden C.M. jährlich, die hälftig im
Januar und Juli ausgezahlt wurden. Eine zusätzliche Ausschüttung aus den Gewinnen der Bank erfolgte als
außerordentliche Dividende nach dem jährlichen Rechnungsabschluss im Januar. Der Wertzuwachs war beachtlich. Hatte
Beethoven 1819 pro Aktie 500 Gulden bezahlen müssen, so stand ihr Kurs im März 1825 bei 1202 Gulden, hatte sich also
mehr als verdoppelt. Da Beethoven die Aktien stets als unveräußerliches Erbe für seinen Neffen Karl betrachtete,
machte er lieber Schulden, als dieses Vermögen zu schmälern. Trotzdem musste er im September 1821 eine Aktie
veräußern, da sich seine finanzielle Situation durch eine längere Krankheit deutlich verschlechtert hatte.
Hatte Beethoven seinen Neffen im Januar 1827 zum Alleinerben "von allem meinem Hab u. Gut worunter
hauptsächlich 7 Bankactien" erklärt, so folgte nach einer Beratung durch seinen Rechtsberater Bach und Stephan von
Breuning - mittlerweile Karls Vormund - wenige Tage vor seinem Tod der Nachtrag: "Mein Neffe Karl Soll alleiniger
Erbe seyn, das Kapital meines Nachlasses soll jedoch Seinen natürlichen oder testamentarischen Erben zufallen." Da
man Sorge hatte, dass Karl mit dem ihm zugedachten Erbe seine hoch verschuldete Mutter unterstützen würde, sollte
Karl nur die Erträge erhalten, das Kapital aber seinen eigenen Erben zufallen. Neben den beiden Aktien, die im
Besitz der Oesterreichischen Nationalbank sind, befinden sich zwei weitere in der Wiener Stadt- und
Landesbibliothek. Deren Aktienbriefe belegen, dass beide Aktien 1864 bzw. 1874 vom Gerichts-Depositen-Amt an die
Tochter von Karl und Caroline Barbara (geb. Nasken) van Beethoven, Karoline Johanna van Beethoven, übertragen
wurden.
Der bedeutendste Anteil an Beethovens Hinterlassenschaft entfiel mit rund 73% auf die Aktien, von deren Existenz nur
wenige Freunde und sein Bruder wussten. Beethoven, der insgesamt ein recht genügsames Leben geführt hat und nur
wenig bis gar kein Geld für Luxusgüter ausgegeben hat, starb also als vermögender Mann. Nur knapp 5% der Wiener
hinterließen gleich hohe oder höhere Werte, 77% lediglich ein Zehntel dessen oder weniger. Mit größter Vorsicht
lässt sich auf der Basis der von Roman Sandgruber ermittelten Umrechnungsfaktoren sein Nachlass auf etwa 145.000 EUR
beziffern. Nur zum Vergleich: Der Hofkapellmeister Antonio Salieri hinterließ das Dreifache, Joseph Haydn,
Kapellmeister und "Hauskomponist" bei Fürst Esterhazy, das Doppelte an Wert.
Beethoven litt sicherlich keine Not im Sinne eines "am Hungertuch nagenden Künstlers". Trotzdem sind seine immer
wiederkehrenden Klagen aber durchaus ernst zu nehmen, zeigen sie doch, dass die Sorge um seine wirtschaftlichen
Verhältnisse stets Teil seines Denkens war und auch sein musste, weil er ja eben keine feste Anstellung hatte.
Letztlich konnte er sich jedoch seinen Wunsch nach einem "unabhängigen Leben", gemeint ist hier vor allem auch
künstlerisch unabhängig, erfüllen.
Währungstabelle
In Österreich zu Beethovens Zeit kursierendes Geld
1. Geld der Österreichischen Erblande bzw. des
Kaisertums Österreich
1753-1858 Konventionswährung (C.M.)
1 Taler = 2 Gulden (fl.C.M.) = 120
Kreuzer
1 Groschen = 3 Kreuzer Böhmen: 1 Gröschl = ¾ Kreuzer
Vorlande: 10 Kreuzer C.M. = 12 Kreuzer
erbländisch
Goldmünzen
1 Dukat = 4 fl.C.M. 30 Kreuzer (amtlicher Kurs 1786-1858)
1762-1811
Wiener Stadt-Banco-Zettel (B.Z.)
1796 1 fl.C.M. = 1 fl.B.Z.
1800 1 fl.C.M. = 1,15 fl.B.Z.
1805 1
fl.C.M. = 1,35 fl.B.Z.
1810 1 fl.C.M. = 4,92 fl.B.Z.
1811 1 fl.C.M. = bis zu 10,94 fl.B.Z.
Nach
1811 Wiener Währung (W.W.)
1 Gulden W.W.= 5 fl.B.Z
30 Kreuzer B.Z.-Teilungsmünzen = 6 Kreuzer W.W.
15 Kreuzer B.Z.-Teilungsmünzen = 3 Kreuzer W.W
1811 1 fl.C.M. = 2,19 fl.W.W.
1813 1 fl.C.M.
= 1,59 fl.W.W.
1815 1 fl.C.M. = 3,51 fl.W.W.
1816 1 fl.C.M. = 3,27 fl.W.W.
1819 1 fl.C.M. = 2,49
fl.W.W.
1816 Rückkehr zur Konventionswährung
1 fl.C.M. = 2,5 fl.W.W. = 12,5 fl.B.Z. (fester Kurs
ab 1820)
3 Kreuzer W.W. = 3/5 Kreuzer C.M.
2. Bewertung fremder Münzen nach
Konventionswährung
Goldmünzen
1 Doppia (Mailand) = 7 fl.C.M. 12 kr.
1 Dukat
(Italien, Bayern, Salzburg, Holland etc.) = 4 fl.C.M. 18 kr. - 4 fl.C.M. 28 kr.
1 Louis d´or (Frankreich) =
7 fl.C.M. 20 kr. - 9 fl.C.M. 12 kr.
1 Max d´or (Bayern) = 5 fl.C.M. 54 kr. - 6 fl.C.M. 45 kr.
1
Pistole = ca. 7 fl.C.M. 30 kr.
1 Souverain d´or = 13 fl.C.M. 20 kr.
Silbermünzen
1
Kronentaler (Holland u.a.) = 2 fl.C.M. 12 kr.
1 Laubtaler (Frankreich) = 2 fl.C.M. 16 kr.
1 Pfund
(England) = 10-11 fl.C.M.
1 Reichstaler (Preußen) = 1 fl.C.M. 30 kr.
1 Rubel (Russland) = 1 fl.C.M. 40
Kr.
1 Scudo (Mailand) = 1 fl.C.M. 46 kr. - 2 fl.C.M.
Näherungsweiser Umrechnungskurs in Euro
1790
1 fl.C.M. = 23,982 Euro
1830 1 fl.C.M. = 15,458 Euro
fl.=Gulden; kr.=Kreuzer
Verzeichnis ausgewählter Literatur
"Alle Noten bringen mich nicht aus den Nöthen!!". Beethoven und das Geld, Begleitbuch zu einer Ausstellung des
Beethoven-Hauses, hrsg. von Nicole Kämpken und Michael Ladenburger, Bonn 2005.
Ludwig van Beethoven. Briefwechsel Gesamtausgabe, hrsg. im Auftrag des Beethoven-Hauses Bonn von Sieghard
Brandenburg, 7 Bände, München 1996.
Ludwig van Beethovens Konversationshefte, hrsg. im Auftrag der Deutschen Staatsbibliothek Berlin von Karl-Heinz
Köhler, Grita Herre u.a., 11 Bände, Leipzig 1972-2001.
Axel Beer, Musik zwischen Komponist, Verlag und Publikum. Die Rahmenbedingungen des Musikschaffens in
Deutschland im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, Tutzing 2000.
Beethoven und andere Wunderkinder, hrsg. von Ingrid Bodsch in Zusammenarbeit mit Otto Biba und Ingrid Fuchs,
Bonn 2003.
Otto Biba, Der Sozial-Status des Musikers, in: Joseph Haydn in seiner Zeit, Ausstellungskatalog, Eisenstadt
1982, S. 105-114.
Ernst Bruckmüller, Zur sozialen Situation des Künstlers, vornehmlich des Musikers, im Biedermeier, in: Künstler
und Gesellschaft im Biedermeier. Wissenschaftliche Tagung 6. bis 8. Oktober 2000, Ruprechtshofen, N.Ö., hrsg.
von Andrea Harrandt und Erich Wolfgang Partsch, Tutzing 2002, S. 11-30.
Hans-Jürgen Gerhard, Vom Leipziger Fuß zur Reichsgoldwährung. Der lange Weg zur "deutschen Währungsunion" von
1871/76, in: Währungsunionen. Beiträge zur Geschichte überregionaler Münz- und Geldpolitik, (= Numismatische
Studien 15) Hamburg 2002, S. 249-288.
Alice M. Hanson, Die zensurierte Muse. Musikleben im Wiener Biedermeier, Wien 1987.
Alice M. Hanson, Incomes and Outgoings in the Vienna of Beethoven and Schubert, in: Music & Letters, Oxford, 64
(1983), S. 173-182.
Andrea Harrandt, Freischaffende-Berufsmusiker-Staatsbeamte. Die Verdienstmöglichkeiten für Komponisten im
Biedermeier, in: Künstler und Gesellschaft im Biedermeier. Wissenschaftliche Tagung 6. bis 8. Oktober 2000,
Ruprechtshofen, N.Ö., hrsg. von Andrea Harrandt und Erich Wolfgang Partsch, Tutzing 2002, S. 107-120.
Ernst Herttrich, Beethovens Widmungsverhalten, in: Der "männliche" und der "weibliche" Beethoven. Bericht über
den Internationalen musikwissenschaftlichen Kongress vom 31. Oktober bis 4. November 2001 an der Universität der
Künste, hrsg. von Cornelia Bartsch, Bonn 2003, S. 221-236.
Eduard Holzmair, Der Staatsbankrott vom Jahre 1811 in der Erinnerung von Zeitgenossen, in: Mitteilungen der
Österreichischen Numismatischen Gesellschaft 17 (1971), S. 18-21.
Michael Ladenburger, Beethoven und die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien: Mitteilungen zum Oratorium "Der
Sieg des Kreuzes" oder: Der Verdienst der Geduld, in: Studien zur Musikwissenschaft 49 (2002), S. 253-297.
Joseph Karl Mayr, Wien im Zeitalter Napoleons. Staatsfinanzen, Lebensverhältnisse, Beamte und Militär, Wien
1940.
Julia Virginia Moore, Beethoven and inflation: hol´ der Henker das Ökonomisch-musikalische!, in: Beethoven
forum, London, 1 (1992), S. 191-223.
Julia Virginia Moore, Beethoven and musical economics, Ann Arbor 1987.
Alfons Pausch, Ludwig van Beethoven. Steuererklärung aus dem Jahre 1818. Eigenhändige Fassion des Komponisten
mit Text des kaiserlichen Steuerpatents von 1806, Köln 1985.
Johann Pezzl, Neue Skizze von Wien, Erstes Heft, Wien 1805.
Johann Pezzl´s Beschreibung von Wien, 7. Ausgabe, Wien 1826.
Günther Probszt, Österreichische Münz- und Geldgeschichte, 3. Auflage, Wien, Köln, Weimar 1994.
Bernhard Prokisch, Die Münzschatzfunde Österreichs aus der Franzosenzeit, in: Mitteilungen des Instituts für
Numismatik 28 (2004), S. 16-24.
Roman Sandgruber, Die Anfänge der Konsumgesellschaft. Konsumgüterverbrauch, Lebensstandard und Alltagskultur in
Österreich im 18. und 19. Jahrhundert, München 1982.
Roman Sandgruber, Wirtschaftsentwicklung, Einkommensverteilung und Alltagsleben zur Zeit Haydns, in: Joseph
Haydn in seiner Zeit, Ausstellungskatalog, Eisenstadt 1982, S. 72-90.
Maynard Solomon, Beethovens Tagebuch 1812-1818, Bonn 2005.
Maynard Solomon, Economic Circumstances of the Beethoven Household in Bonn, in: Journal of the American
Musicological Society 50 (1997), S. 331ff.
Alexander Wheelock Thayer, Ludwig van Beethovens Leben, fortgeführt von Hermann Deiters und vollendet von Hugo
Riemann, Bd. 3, 2.Auflage, Leipzig 1911 und Bd. 5, Leipzig 1908.
Peter Urbanitsch, Zum Stellenwert des Mäzenatentums im frühen 19. Jahrhundert (unter besonderer Berücksichtigung
der Komponisten), in: Künstler und Gesellschaft im Biedermeier. Wissenschaftliche Tagung 6. bis 8. Oktober 2000,
Ruprechtshofen, N.Ö., hrsg. von Andrea Harrandt und Erich Wolfgang Partsch, Tutzing 2002, S. 31-57.
Vom Pfennig zum Euro. Geld aus Wien, Katalog zur Sonderausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien, Wien
2002.
Impressum
Herausgeber:
Beethoven-Haus Bonn
Bonngasse 24-26
D-53111 Bonn
Deutschland
Inhalte der Internet-Ausstellung:
Dr. Nicole Kämpken
Dr. Michael Ladenburger
Die Sonderausstellung wurde vom 13.05.2005 bis zum 25.08.2005 im Beethoven-Haus gezeigt.